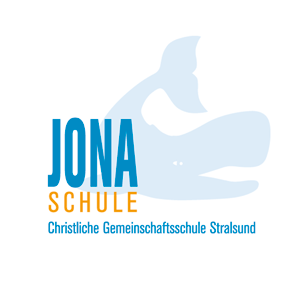Paludi...Was? – Ein Einblick in nachhaltige Moorbewirtschaftung
Am 28. Januar 2025 erhielt die Klasse 9b im Geographieunterricht Besuch von Felix Klimm, einem Lehrer und Experten für Unterrichtsmaterialien zur Paludikultur. Er ist derzeit an der Universität Greifswald im Projekt „WIR!-Plant³-Regionales Lernen Bioökonomie“ tätig. In diesem Rahmen wurden bereits innovative Exkursions- und Unterrichtsmaterialien zum Thema Paludikultur entwickelt, die aktuell erprobt und evaluiert werden.
Was ist Paludikultur – und warum ist sie so wichtig?
Mecklenburg-Vorpommern gehört mit 300.000 Hektar Moorfläche zu den moorreichsten Bundesländern Deutschlands. Zwischen 1960 und 1990 wurden viele Moore jedoch tiefgreifend entwässert, um sie für die intensive landwirtschaftliche Nutzung vorzubereiten. Dabei ging eine ihrer wichtigsten Funktionen verloren: die langfristige Speicherung von Kohlenstoff.
Intakte Moore wachsen im Durchschnitt 1 mm pro Jahr, wobei sich organisches Material ansammelt und Kohlenstoff dauerhaft gebunden wird. Werden Moore jedoch entwässert, gelangt Sauerstoff an den im Torf gespeicherten Kohlenstoff, wodurch sich das organische Material zersetzt und jährlich große Mengen zuvor gespeicherten CO₂ freigesetzt werden. Ein entwässertes, nicht intaktes Moor kann dabei pro Jahr bis zu 1 cm an Torfschicht verlieren. Die Folge: Es trägt aktiv zur Erderwärmung bei.
Hier setzt die Paludikultur an: Sie beschreibt die nachhaltige forst- und landwirtschaftliche Nutzung von nassen oder wiedervernässten Moorflächen. Indem Moore als natürliche Kohlenstoffsenken erhalten bleiben, kann dieser Prozess umgekehrt werden. Gleichzeitig ermöglichen alternative Anbaumethoden auf nassen Flächen eine wirtschaftliche Nutzung – beispielsweise der Anbau von Rohrkolben oder Torfmoosen als nachhaltige Rohstoffe.
Lernen mit der Mystery-Methode
Um das Thema anschaulich zu vermitteln, wurde im Unterricht die Mystery-Methode angewandt. Diese funktioniert ähnlich wie ein Kriminalfall: Die SchülerInnen erhielten zahlreiche Materialkarten mit Informationen, die sie analysierten, sortierten und schließlich in einem logischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang verknüpften. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig und komplex das Thema ist.
Durch diese Methode konnten die SchülerInnen nicht nur das Zusammenspiel zwischen Klimawandel und Mooren besser verstehen, sondern auch lernen, sich in komplexen Themenfeldern zurechtzufinden. Die Fähigkeit, relevante Informationen herauszufiltern und Zusammenhänge herzustellen, ist eine zentrale Kompetenz im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit.
L. Preuß